Der folgende Bericht ist in der NZZ vom Mittwoch, 24. November 2004 erschienen (Nr. 275):
Ein Pionier der Entwicklungshilfe auf Flores / Indonesien
Seit 27 Jahren wirkt der Steyler Missionar Ernst Waser auf der indonesischen Insel Flores. Unermüdlich setzt er sich nebst der Pastoral für Schulen, Trinkwasser und Strassenbau ein. Dieses Jahr feierte er seinen 75. Geburtstag und sein Goldenes Priesterjubiläum.
Eine Fahrt von Ruteng, dem Distrikthauptort von Westflores, zum Fischerdorf Bari an der Nordküste lässt den europäischen Besucher eintauchen in eine ganz andere, von unserem Alltag weit entfernte Welt. Für die 65 km benötigt man auf der schmalen, löchrigen und äusserst kurvigen Naturstrasse viereinhalb Stunden.
An den entlang der Strasse aufgereihten einfachen Bauernhäusern und Weilern kommt so selten ein Vehikel vorbei, dass die Leute von ihrer Beschäftigung aufschauen und freundlich grüssen; Kinder kommen herbeigerannt, rufen und gestikulieren. Wir fahren an Reisfeldern vorbei, die bestellt werden, sehen Frauen beim Stampfen der Kaffeebeeren, beim Ausbreiten der an der Sonne zu trocknenden Jamswurzeln, beim Weben der traditionellen Stoffe. Viele Männer sitzen allein oder in kleinen Gruppen herum. Ausser den Beamten, den Lehrerinnen und Lehrern, leben hier ausschliesslich Bauernfamilien als Selbstversorger. Die Strasse steigt vom 1000 m ü. M. gelegenen Ruteng aus etwa 300 Meter an und führt bald in eine sehr zerklüftete Gebirgsregion. Das vulkanische Gestein wurde tief erodiert, sodass scharfe Gräte und steile Gräben das Bergland prägen. Der ursprüngliche Gebirgswald musste fast überall Reisterrassen weichen, die steil und schmal die Hänge erklimmen. Nur dank der Ausdehnung der Ackerfläche kann sich die wachsende Bevölkerung weiterhin selbst ernähren. Wenn man sich die zwischen 4 und 6 schwankende Kinderzahl je Familie vergegenwärtigt, wird der grosse Landhunger verständlich. Das besiedelte Gebiet muss in bisher unwegsame Gegenden ausgedehnt werden. Dieser Zivilisationsprozess wird vom Staat kaum oder nur ungenügend begleitet. Der Staat ist für die nach wie vor im Sippenverband lebende Bevölkerung ohnehin ein abstrakter Begriff. Eine Zivilbevölkerung in unserem Sinn existiert nicht. Die Leute helfen sich selbst, bauen einfache Holzhütten, legen Felder an, pflanzen nebst Reis und Jams einige Kaffeesträucher, um durch den Erlös aus den getrockneten Kaffeebohnen zu etwas Bargeld zu kommen. Das ursprünglich den Sippen zugeteilte Land wurde meist auf die Familien aufgeteilt; Staatsland ist nicht mehr viel vorhanden. Mögliche Landprobleme zeichnen sich am Horizont ab, zu Streitigkeiten ist es schon mehrfach gekommen. Doch ein dringenderes Problem für das tägliche Leben ist die
Versorgung mit Trinkwasser
Wasser, der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts, ist auf der gebirgigen Insel vorhanden. Es müssen aber ergiebige Quellen gesucht und diese gefasst werden, eine Arbeit, die die Möglichkeiten der Sippen übersteigt. Ernst Waser wurde zum Pionier der Trinkwasserversorgung auf Westflores. Er wandte seine Kenntnisse an, die er als Jugendlicher bei seinem Vater auf dem Bauernhof und auf den Alpweiden Nidwaldens erworben hatte. So kamen viele kleine Siedlungen zu sauberem Wasser. Es floss verschiedenen Zapfstellen zu, wo es in Behälter abgefüllt und nach Hause gebracht werden konnte. Doch niemand fühlte sich verantwortlich und unterhielt die Anlagen. Oft wurden die Leitungen angezapft oder umgeleitet. Die Leute an den letzten Zapfstellen hatten dabei das Nachsehen: Das anfänglich munter fliessende Wasser blieb für lange Zeit oder für immer aus. Schade für die Anfangsinvestition aus Entwicklungshilfegeldern und den enormen Aufwand beim Wasserbau! Ernst Waser gab nicht auf und entwickelte ein neues Konzept, das seit einigen Jahren bei allen Neu-Erschliessungen und Erneuerungen angewandt wird. Es werden nur noch Hausanschlüsse mit Wasseruhren erstellt. Die Abonnenten müssen für das Wasser einen moderaten Preis bezahlen (bei sparsamem Verbrauch im Monat so viel wie ein Päckchen Zigaretten kostet) und haben so alles Interesse an intakten Anlagen. Mit den Wasserzinsen wartet die eigens dafür gegründete Unterhaltsfirma die Anlagen und legt einen Fonds an für Erweiterungen und Erneuerungen. Dieses Modell funktioniert einwandfrei und ist bei verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen auf so grosses Interesse gestossen, dass es mittlerweile vielerorts in den Ländern des Südens angewandt wird. Das Geld für die Planung und den Bau der Wasserversorgung stammt meist aus der Entwicklungshilfe. Im Fall von Ernst Waser ist es durch die Vermittlung des Schweizer Botschafters in Indonesien und das Einverständnis des zuständigen Gouverneurs in der Provinzhauptstadt Kupang gelungen, dass Schweizer Entwicklungshilfegelder direkt nach Ruteng flossen. Dort unterhielt „Swiss Intercorporation“ fünf Jahre lang ein Büro, das für den Wasser- und Strassenbau eng mit Ernst Waser zusammenarbeitete. Für die Ausführung der Projekte wurde eine eigene Baufirma gegründet, die aus der Pfarreiwerkstätte herausgewachsen ist. Auf diese Weise wurde das Geld optimal eingesetzt und brachte den doppelten Effekt der Wasserversorgung für viele Leute und des gesicherten Lohnes für die Arbeiter. Ernst Waser hat dabei immer ohne Lohn gearbeitet und seinen Einsatz als moderne Mission aufgefasst. Diese Pionierzeiten sind vorbei. Mittlerweile gibt es noch einige weitere Baufirmen und alle Aufträge werden vom Staat vergeben. Die Zentralregierung in Jakarta erhält für Wasser- und Strassenbau Entwicklungshilfegelder von der Weltbank oder Partnerländern. Sie zweigt rund 20% davon für sich ab und gibt den verbleibenden Betrag an den zuständigen Gouverneur weiter. Dieser behält „natürlich“ auch 20% für sich und übergibt die Restsumme dem Distriktchef der betreffenden Region mit dem Auftrag, für die prompte und fachmännische Erledigung des Bauvorhabens besorgt zu sein. So wird auf die Unternehmer ein grosser Druck ausgeübt für eine günstige und schnelle Ausführung. Die von Ernst Waser gegründete, nicht gewinnorientierte Firma hat unter der Bevölkerung den besten Ruf. Überall kennt man Pater Waser und weiss nur Positives von ihm zu berichten. Das hat u.a. dazu geführt, dass zur Zeit an einem grossen Auftrag der Distriktregierung zur umfassenden Erneuerung der Trinkwasserversorgung von Labuhanbajo (Ausgangsort für den Komodo-Tourismus und daher in Entwicklung begriffen) gearbeitet wird. Um illegalem Abzapfen zuvorzukommen, hat Ernst Waser zuerst das Umland der Stadt mit Trinkwasser versorgt.
Ökumene in Bari
Ernst Waser hat das Problem früh erkannt und mit den Muslimen Kontakt aufgenommen. Er gewann das Vertrauen der Dorfältesten und insbesondere des geistigen Führers, eines Hadschi. So konnte an der Küste Land gekauft werden zur Ansiedlung von jungen Bauernfamilien. Für die mittlerweile recht zahlreichen Siedler im unmittelbaren Hinterland ist eine katholische Kirche gebaut worden, die nach der Fertigstellung des Innenausbaus am 11. November dieses Jahres , dem Martinstag, geweiht werden wird.
Die Architektur ist recht ungewöhnlich und orientiert sich an der Moschee des Ortes. Man kann von 3 symmetrischen Haupteingängen her, von Osten, Norden und Süden, in die Kirche gelangen. In der Mitte, an der Stelle der Kuppel in der Moschee, erhebt sich ein kleiner Turm. Die Eingänge symbolisieren den dreifaltigen Gott, der Turm in der Mitte den einen dreifaltigen Gott. Der Altar ist aus Korallensteinen erbaut, die aus den Feldern eines Muslims namens Abraham stammen. Anstelle eines Kruzifix wird ein grosses Mosaik die Chorwand zieren. Es zeigt einen Brotkorb und zwei Fische mit dem griechischen Kodewort „IXTHUS“ (Fisch). Die Muslime werden an der Kirchweihe teilnehmen und zeigen sich so auch dankbar dafür, dass Ernst Waser zuvor ihre Moschee gründlich renoviert hat. Sie sind auch glücklich darüber, dass ihre aus Sodbrunnen gespiesene, ungenügende und typhusträchtige Wasserversorgung ersetzt wurde durch Quellfassungen in den Bergen, lange Wasserleitungen und Hausanschlüsse. Für die Bevölkerung einer vorgelagerten kleinen Insel, deren Grundwasservorrat in der Trockenzeit regelmässig zur Neige geht, wurde eigens an der Küste ein Anschluss mit Zähler installiert. Jeden Morgen wird nun der Tagesbedarf an Trinkwasser per Boot geholt. Das ganze Werk wurde von der schweizerischen DEZA finanziert und zur Ausführung weilte ein Ingenieur von „Swiss Intercorporation“ bei Ernst Waser. Das Zusammenleben funktioniert mittlerweile so gut, dass eine kürzlich gelandete Gruppe von jungen fundamentalistischen Muslimen, die ihre Glaubensbrüder zu einem militanteren Islam anstacheln wollten, ultimativ zurückgeschickt wurde.
Strassenbau
Bevor überhaupt ein Gebiet mit Trinkwasser versorgt werden kann, muss für den Bau der nötigen Anlagen eine Strasse vorhanden sein. Das ist auf Flores keine Selbstverständlichkeit. Eine einzige, recht gut unterhaltene Staatsstrasse quert die Insel der Länge nach. Davon zweigen Stichstrassen in die Gebirgsregionen ab. Meist handelt es sich dabei um mit Steinen befestigte, holprige Wege, die in der Regenzeit fast unpassierbar werden. Für viele dieser Wege hat Ernst Waser die beste Streckenführung gesucht; manche hat er durch die pfarreieigene Firma gebaut, unterstützt und finanziert durch die schweizerische Entwicklungshilfe. Oft mussten die Dorfbewohner Fronarbeit leisten, damit sie zu einer Verbindung kamen. Das letzte Drittel der Strasse nach Bari ist vor wenigen Jahren durch Ernst Waser so gebaut worden. Vorher war dieses Fischerdorf eine nur vom Meer her zugängliche Siedlungsinsel, die von Zuzügern aus Sulawesi und Sumbawa bewohnt wurde. Durch die Strasse wurden Kontakte zwischen der einheimischen Bergbevölkerung und den zugezogenen Muslimen möglich. Händler kamen auf den lokalen Markt und kauften die Frischfische auf. Siedler aus der Gebirgsregion liessen sich in Küstennähe nieder. Die Regierung erkannte das Entwicklungspotenzial und erhob die Region zum Bezirk und Bari zum Bezirkshauptort. Doch die Entwicklung barg grosse Risiken, denn die muslimische Fischerbevölkerung und die katholischen Bauern waren sich fremd.
Schulen und Internate
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle Schulen auf Flores in kirchlicher Hand. Die holländische Kolonialmacht kümmerte sich auf dieser rückständigen Insel nicht um die Bevölkerung, sie unterhielt nur Beziehungen zu den Häuptlingen. Die ersten Weissen, die mit den Leuten in engeren Kontakt traten, waren deutsche Missionare, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg aus den deutschen Kolonien in Afrika vertrieben worden waren. In den Jahren nach 1920 kamen holländische Steyler Missionare und bauten ein soziales Netz auf. Sie christianisierten die animistischen Inselbewohner, errichteten Kirchen und gründeten die ersten Schulen. Dieser langsame Zivilisationsprozess hielt auch nach der Unabhängigkeit Indonesiens im Jahre 1949 an. Die Regierung unter Staatschef Sukarno anerkannte die Leistungen der Missionare und gewährte ihnen im Gegensatz zu den niederländischen Kolonialbeamten und Plantagenbesitzern weiterhin Gastrecht. Dies erklärt, dass ca. 85% der Bevölkerung von Flores bis heute katholisch sind. Nach und nach hat der Staat eine Verwaltung aufgebaut und die Primarschulen übernommen. Es besteht eine Schulpflicht von acht Jahren. Doch bis zu einem Drittel der Schülerinnen und Schüler fallen durch die Maschen des Netzes und leben nach wenigen Jahren Schulbildung als sogenannte „drop outs“ ohne Perspektiven auf dem Land. Aus der Erkenntnis, dass die Zukunft jedes Volkes in der Jugend liegt und dass eine gute Bildung das Tor zu einer besseren Zukunft öffnet, gründete Ernst Waser in Kuwu, einem zu seiner Pfarrei gehörigen und nahe des Distrikthauptortes Ruteng gelegenen Dorf, eine Sekundar- und eine Mittelschule. Diese Schulen halten sich an die staatlichen Lehrpläne und bemühen sich darüber hinaus um eine im christlichen Sinn ethisch fundierte Bildung. Auch sollen die Schülerinnen und Schüler so betreut werden, dass sie gute Schulabschlüsse erreichen können. Dazu bedarf es eines motivierten Lehrkörpers. Die Auswahl und Anstellung der Lehrerinnen und Lehrer ist zu einer wichtigen und oft schwierigen Aufgabe für Ernst Waser geworden. In einem armen, bäuerlichen Umfeld ohne engmaschiges Netz öffentlicher Verkehrsmittel ist der Besuch von Sekundar- und Mittelschulen ungleich schwieriger als bei uns. Um allen begabten Jugendlichen ähnliche Chancen zu geben, hat Ernst Waser einfache Schülerwohnheime gebaut. Mit dem Bau der verschiedenen Gebäude wurde die pfarreieigene Werkstatt betreut, die damit zu einer eigentlichen Baufirma wurde. Auch die Möbel, nebst Schulbänken und Stühlen zweistöckige Betten und einfache Kästen sowie Tische und Stühle für die Esssäle, stammen aus dieser Werkstatt. Der gute Ruf der „SMP, SMA Santu Klaus“ , der nach Bruder Niklaus von Flüe benannten Schule, liess sie in kurzer Zeit auf über 1000 Schülerinnen und Schüler anwachsen. Beflügelt von diesem Erfolg und beseelt von der Wichtigkeit einer christlichen Erziehung, ermunterte Ernst Waser andere Pfarreien, eigene Oberstufenschulen mit Internaten zu eröffnen. Beim Bau und der Ausrüstung war er nach Kräften behilflich, die meisten Gebäude wurden durch die von ihm geleitete Werkstätte und Baufirma erstellt, finanziell unterstützt von einem Freundeskreis in der Schweiz. In letzter Zeit sind vier Schulzentren in ländlichen Entwicklungsgebieten mit starker Bevölkerungszunahme ausgebaut und im Schulverband „Santu Klaus“ zusammengeschlossen worden. Ein Schulbesuch vermittelt dem europäischen Besucher unvergessliche Eindrücke. In den kargen, einfach aber zweckmässig eingerichteten Schulzimmern sitzen aufgeweckt wirkende Schülerinnen und Schüler in sauberen Schuluniformen an ihren Tischen. Sie notieren sorgfältig ins Heft, was die Lehrerin oder der Lehrer an der Wandtafel doziert. Dem Besucher präsentieren sie sich auf Englisch; die Mutigen beginnen Fragen zu stellen und bald kann man sich des Ansturms an Neigier kaum erwehren. Im Vordergrund stehen Fragen nach der Familie (die Kinderzahl ist sehr wichtig) und dem Herkunftsland. Für eine vertiefte Unterhaltung reichen meist die Englischkenntnisse nicht aus. Wenn man die Schülerinnen und Schüler beim Essen und im Schülerheim besucht, erlebt man einfachste, für uns fast beschämende Verhältnisse. Alle drei täglichen Mahlzeiten bestehen aus Reis und abgekochtem Wasser. Ein- bis zweimal in der Woche kommt dazu Fisch auf den Tisch, einmal etwas Gemüse. Die Jugendlichen erhalten in den grossen Schlafsälen, nach Geschlechtern getrennt, ein Bett zugewiesen und zu zweit ein Kästchen. Das reicht, denn sie besitzen fast nichts; geschlafen wird meist ohne Matratze und nur mit einer einfachen Decke. Für das Studium und die Aufgaben stehen spezielle Zimmer zur Verfügung. Es erstaunt, wie die Jugendlichen unter diesen Umständen wissbegierig und optimistisch, sauber und gepflegt dem Schulunterricht folgen.
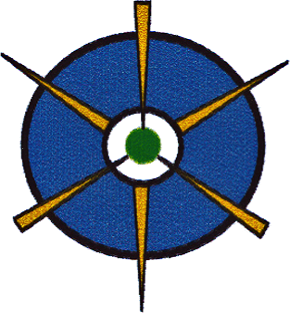 FREUNDESKREIS SANTU KLAUS
FREUNDESKREIS SANTU KLAUS

